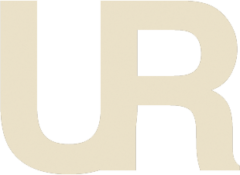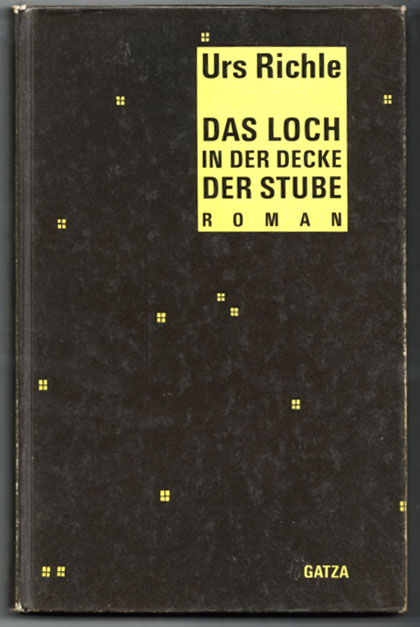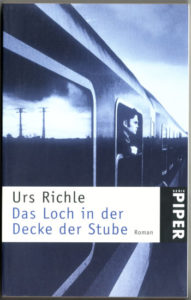Roman, Gatza Verlag, Berlin, 1992
Weitere Ausgaben:
- Zweite Auflage
- Taschenbuch, 1999
Zu diesem Buch: Berlin einfach
Ich hatte es mir anders vorgestellt, irgendwie pathetischer, wegzufahren mit einfacher Fahrt, nichts mehr zu haben als diesen Koffer, die zwei Bücher in meiner Tasche und den bestimmten Entschluss, nicht wieder zurückzukehren. Eine gewisse Absolutheit hatte ich mir vorgestellt, den totalen Augenblick des Neubeginns, eine Explosion, eine Revolution, einen Putsch in meinem Kopf, in meinem Bauch, während der ganzen langen Fahrt, sogar dass mir schlecht würde, hatte mir vorgestellt.
Stattdessen sah ich mich unverändert im Spiegel des Fensterglases als unauffälliger, ganz gewöhnlicher Passagier, der die draussen vorbeiziehende Landschaft betrachtet.
Das Profane dieses Augenblicks überfiel mich wie der Schlaf nach einem langen aber unbedeutenden Tag.
Dann plötzlich das Aufreissen der Waggontür, Licht, Passkontrolle durch die DDR-Zöllner, der aufgeklappte Bauchladen, Formulare, Stempel, das Ausstellen eines Durchreisevisums, während der Zug von Grenzbahnhof zu Grenzbahnhof rollt, ohne Zwischenhalt.
Einmal nur ein Paket, das, wie mir schien, an einem x-bliebigen Ort mitten in der DDR aus dem Fenster meines Nachbarabteils geworfen wurde – verhaftet und abgeführt wurde niemand.
Schliesslich nahm man die Besonderheit dieser Zugstrecke hin wie das Vorzeigen des Fahrscheins auf allen anderen Strecken. Was hinter den Stacheldrahtzäunen, den Leuchttürmen, was in den dunklen, finsteren Strassen und Häusern der vorüberziehenden Dörfer vor sich ging, war und blieb ein Geheimnis, eine Kuriosität.
Ich stieg aus und war, wo ich hin wollte.
Bereits damals, als ich im September 89 «für immer» wie ich dachte, in Berlin ankam, zirkulierten Spekulationen über die Entwicklung der DDR, über die Mauer und die politischen Ereignisse, die sich angebahnt hatten. Aber Sicheres wollte und konnte niemand sagen und wenn, dann rechnete man in Zehn-, Zwanzig-, wenn nicht sogar in Fünfzigjahresschritten.
Der Alltag also wie immer: rollende U-Bahnen, Wohnungsssuche, Döner-Kebab-Stände, fallendes gelbglitzerndes Laub in der diesigen Herbstsonne. Ich bewohnte ein grossräumiges Zimmer im fünften Stock eines alten Berliner Hinterhauses. Toilette auf dem Flur, nur kaltes Wasser und Kohleheizung im Winter, abwaschen, Zähne putzten und waschen im selben kleinen Emaillavabo in der schmalen Küche – aber es gefiel mir. Endlich war ich aus dem Dorf raus, endlich war mein Traum Realität geworden, ich hatte die Schweiz verlassen.
Aber ich hatte, wie ich sehr schnell feststellte, nicht die Schweiz, sondern die Ostschweiz verlassen. Denn wenn ich von der Schweiz erzählte, dann erzählte ich von den Churfirsten und den Bauern im Appenzellerland. Trotzdem war ich froh, endlich weg zu sein.
Und kaum war ich in Berlin einigermassen untergekommen, zerbrach nicht nur die Mauer rings um die Insel West-Berlin, sondern mit ihr auch meine Illusion, emigriert zu sein. Am 10. November, nachdem ich die Nacht des Aufbruchs verschlafen hatte, stand ich mit einem Schweizer Kollegen verwundert am Check-Point Charlie und schaut fassungslos dem herüberrollenden Konvoi von Trabbis zu, die mit Jubel, Champagner und Blumen empfangen wurden. Und gleichzeitig lief es mir kalt über den Rücken, als das Jubilieren und Champagner-Spritzen abrupt abbrach, als zwischen den DDR-Trabbis plötzlich ein Auto mit polnischem Kennzeichen und genauso verwunderten Passagieren über die Grenze rollte. Dieses Zurückhalten der Blumengrüsse für die Polnischen Landsleute liess mich in der euphorischen Stimmung augenblicklich erkalten. Seltsam fremd fühlte ich mich schlagartig. Und wenn ich jetzt zurückdenke, waren diese wenigen Sekunden der Stille der erste und wohl bisher einzige Augenblick gewesen, während dem ich mich durch Mark und Bein als Schweizer fühlte. Zum ersten Mal realisierte ich bewusst, dass ich nicht mehr in der Schweiz, sondern in einem andern Land war, dass sich hier etwas abspielte, das mich nicht in der gleichen Weise anging, wie all die begeisterten und vor Freude weinenden Deutschen. Es war, als wäre ich mit einem Schlag in meine «Heimat», auf die Toggenburger Hügel zurückgeworfen worden.
Von diesem Augenblick an nahm die Frage, warum und wieso ich unter allen Umständen und allen Entbehrungen nach Berlin ziehen wollte, von mir Besitz. Kein Demonstration, keine Diskussion verging mehr, ohne dass ich mir diese Frage insgeheim stellte. Aber schliesslich dauerte es noch mehr als eineinhalb Jahre, bis ich darüber schreiben konnte. Erst im Frühjahr 1991 stülpte sich die Geschichte meines ersten Romans DAS LOCH IN DER DECKE DER STUBE in sehr kurzer Zeit richtiggehend aus mir heraus. Inspiriert zu der Geschichte hatte mich ein Kapitel aus Foucaults Studie Ãœberwachen und Strafen, in welchem er die architektonische Struktur eines kreisförmig gebauten, panoptischen Gefängnisses des 19. Jahrhunderts mit gesellschaftlichen Beobachtungs- und Kontrollmechanismen vergleicht. Auffallend dabei ist, dass die Struktur des Panoptikums (ein Rundbau mit Zellen, in der Mitte ein Turm für die Wärter) genau der Struktur eines typisch schweizerischen Dorfplatzes entspricht. Am 22. November 1990 hatte Dürrenmatt in seiner Rede an V. Havel die Schweiz ebenfalls mit einem Gefängnis verglichen.
Anders als Dürrenmatt sehe ich das Gefängnis Schweiz nicht als Metapher für eine Nation in ihrer Einigelung, sondern als ein ganz alltägliches Problem der Verhaltensregulierung. Was mich damals beschäftigte, war die Frage, was mir denn Berlin im Vergleich zu Wattwil oder Gais, wo ich ein Jahr als Lehrer gearbeitet hatte, so viel angenehmer machte. Der Begriff Enge ist hier nicht neue aber immer noch naheliegend. Nur waren mir die Nachbarn in Berlin plötzlich viel näher, sassen viel enger auf, unter und neben mir. Der Hinterhof war eine ununterbrochene Geräuschkulisse menschlicher Intimität, die ich eigentlich nicht suchte, die mich aber seltsamerweise auch nicht störte. Also musste es im schweizer Provinzkaff etwas anderes geben, was mir die Nähe der andern unerträglich machte und in mir den Drang wegzugehen verursachte. Die Nähe im Dorf ist in ihrer Art viel irrationaler. Trifft man im Dorf jemanden und wechselt ein paar Worte, ist man selbst nie sicher, wem dieser Nachbar was und wie weitererzählt. Der andere, der nicht vorhandene Nachbar wird durch die Möglichkeit des Mitwissens ununterbrochen präsent. Dieser imaginäre Nachbar, in dem sich alle andern, nicht anwesenden, aber bekannten und möglicherweise mit dem gerade gegenüberstehenden Gesprächspartner in Verbindung stehenden Nachbarn spiegeln, dieser orwellsche Big-Nachbar, der sich immer wieder unbemerkt zwischen mich und meinen Gesprächspartner schleicht, während wir über das Wetter reden oder den einen oder anderen Nachbar, ist, solange ich mich vor ihm fürchte, unvergleichlich viel bedrohlicher als eine Nervensäge, die die Musik nicht runterdreht, obwohl man schon zweimal geklopft hat und einmal persönlich vorbeigegangen ist. Dieser nicht anwesende und doch anwesende Big-Nachbar, der die ganze Dorfgemeinschaft umfasst, sitzt, im Bild des panoptischen Gefängnisses, in der Mitte, im Turm und funktioniert als Kontrollinstanz. Jeder einzelne sitzt in seiner Zelle und weiss nie, wann er von wem wie beobachtet wird. Diese mögliche Dauerkontrolle, die das panoptische Gefängnis so sicher machte, regelt im Dorf persönliches Verhalten im Einzelfall. Die ständige Angst von allen andern be- und verurteilt zu werden, wird über das praktische Mittel der Freundlichkeit reguliert und unter Kontrolle gehalten. Das führt dazu, dass alle nett und freundlich zueinander sind, obwohl eigentlich alle im Krieg miteinander stehen.
Der Roman DAS LOCH IN DER DECKE DER STUBE war für mich ein Versuch, dieses Prinzip der Verhaltensregulierung zu verstehen, mit dem Ziel, herauszufinden, warum ich damals im September 1989 um jeden Preis Richtung Osten auswandern wollte, während tausende von Menschen genau in die Gegenrichtung zogen. Es war auch ein Schritt, um auf die Schweiz als Ort, in dem ich aufgewachsen bin, wieder zuzugehen. Dass es dabei literarisch für mich nicht um eine Attacke gegen das politische System Schweiz gehen konnte, war von Anfang an klar. Es ist ein Blick auf ein persönliches Erlebnis, in der Hoffnung, dass er auch ausserhalb meines eigenen Interesses Fragen aufwerfe.